| |
 |
 |
 |
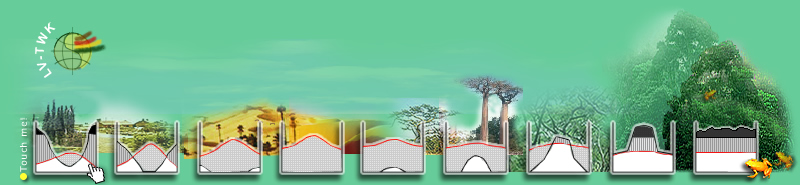 |
|
Vegetationsökologie
Tropischer & Subtropischer Klimate (LV von 1986 - 2016)
|
| |
|
ZM28 |
|
sEp
|
|
S.
B3
|
|
|
|
|
Trockene Mittelbreiten - die
Prärien Nordamerikas ...
| |
|
 |
Zusätzlich
wurde hier die VL Dr. Uwe Starfingers angeboten. |
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
Die
Prärien N-Amerikas |
| |
|
| |
Im Vergleich
zu den weite Flächen einnehmenden Trockenen Mittelbreiten Eurasiens,
sind die in N-Amerika Prärien genannten Landschaften des Zonobioms
VII (nach Heinrich Walter) wesentlich kleiner. Extrem
kontinentale Gebiete wie in Zentralasien fehlen vollständig.
Die Prärien
(Great Plains) erstrecken sich von Osten nach Westen über
eine Entfernung von etwa 1.000 (1.200) km und von Norden nach Süden
von 55° bis 30° N über eine Entfernung von etwa 2.700km.
 Einen sehr guten Überblick zur Geschichte und Ausdehnung, zur
Biodiversität sowie den verschiedenen ökologischen Einheiten
bieten
Einen sehr guten Überblick zur Geschichte und Ausdehnung, zur
Biodiversität sowie den verschiedenen ökologischen Einheiten
bieten
|
| |
 |
Lassen
sich bei den klimatisch bzw. thermo-hygrisch bestimmten Zonen
von Walter und Schultz noch in weiten Teilen Übereinstimmungen
feststellen, so weichen die amerikanischen Flächenzuweisungen
(soweit zugänglich) vor allem in ihren Randbereichen
voneinander ab. Eine flächengleiche und einheitliche
Zuordnung der verschiedenen Prairietypen existiert nicht.
Dies
hat im Wesentlichen damit zu tun, dass US-Darstellungen die
aktuelle und die europäischen die potentielle Situation
beschreiben.
Als Beispiele
sollen hier die kartografischen Darstellungen des INDR
(Indiana Department of Natural Resources - siehe auch Karte
unten! -
und des  NABSI
(The North American Bird Conservation Initiative - ausgewiesene
Regionen entsprechen Landschaftseinheiten [last
date of access: 19.01.12]) genannt werden. Eine Übereinstimmung
kann lediglich in der Abfolge der Vegetationstypen von West
nach Ost gefunden werden. NABSI
(The North American Bird Conservation Initiative - ausgewiesene
Regionen entsprechen Landschaftseinheiten [last
date of access: 19.01.12]) genannt werden. Eine Übereinstimmung
kann lediglich in der Abfolge der Vegetationstypen von West
nach Ost gefunden werden.
|
|
| |
|
| |
 Abb.
B3-02: Abb.
B3-02:
Topografie
der westlichen USA als Satellitenbild mit dem 'Great Basin', den angrenzenden
Plateaus und den östlich angrenzenden 'Great Plains' . |
| |
|
| |
|
| |
 Zonobiom
VII Nordamerikas mit Übergangsgebieten nach
Walter, 1968:
Zonobiom
VII Nordamerikas mit Übergangsgebieten nach
Walter, 1968: |
| |
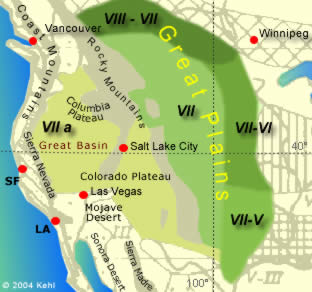 |
- VIII
- VII
= Übergangsgebiet kalt-gemässigt (boreal) bis
typisch gemässigt (nemoral), nördliches Makro-Mosaik
aus Prärie und reinen Espenbeständen (Populus
tremuloides)
- VII
- VI =
Waldsteppe als Übergangszone (nemoral mit kurzer Frostperiode)
- VII
- V
= Übergang zum warm-temperierten Zonobiom
- VII
=
Arid-gemässigtes Klima mit kalten kontinentalen Wintern
- VII
a = Subzonobiom der ariden Halbwüsten
Abweichend
zu den Verhältnissen in Eurasien grenzen alle Präriezonen
im Norden an das ZB VIII der Nadelwälder, stösst
die Langgras-Prärie im Osten (potentiell) in breiter
Front an das ZB VI der Laubwälder und im Süden
an den Golf von Mexiko bzw. an das ZB II der Savannen
(tropisches hunido-arides Sommerregengebiet), im SW tw
an das ZB III der Sonorawüste (subtropisches arides
Wüstenklima)
|
|
| |
 Abb.
B3-03: Abb.
B3-03:
|
| |
Verbreitung
des Zonobioms VII und Übergangszonen (Grenzen stark vereinfacht) |
| |
|
| |
|
| |
 Trockene
Mittelbreiten Nordamerikas nach
Schultz (2000, S. 298):
Trockene
Mittelbreiten Nordamerikas nach
Schultz (2000, S. 298): |
| |
|
| |
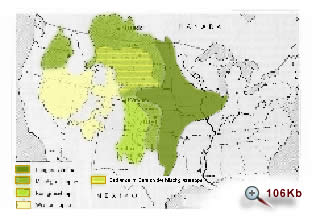 |
 Abb.
B3-04: Abb.
B3-04:
Ursprüngliche
Verbreitung winterkalter Steppen in Nordamerika und Lage der
IBP (International Biological Programm) - Untersuchungsorte.
Nach der Karte von Schultz (2000), stark
modifiziert und Badlands hinzugefügt.
|
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
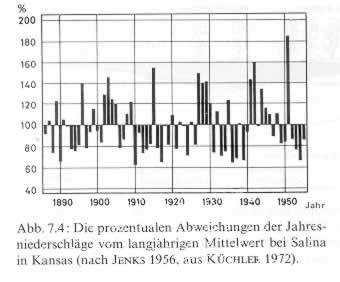 Wesentliches
Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains
mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.
Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu
Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden
verantwortlich. Wesentliches
Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains
mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.
Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu
Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden
verantwortlich.
 Abb.
B3-05: Abb.
B3-05:
aus Walter & Breckle (1991, S. 348)
Wie bereits
erwähnt, liegen die Prärien auf der Ostseite der Gebirgskette
(Leelage) der Rocky Mtns, was zur Folge hat, dass die sich ostseitig
anschliessenden Landschaften niederschlagsbenachteiligt sind. Entsprechend
zeigt sich ein ausgeprägter Niederschlagsgradient von West
nach Ost, bei welchem die Niederschläge von West (Ostabhang
der Rocky Mountains) nach Ost kontinuierlich ansteigen (vg. Abb.
unten!).
Weiterhin ist
zu berücksichtigen, dass das Gebiet der Prärien in ihrer
West-Ost-Erstreckung einer schiefen Ebene gleicht, bei welcher
das Gelände am Fusse des Gebirgszuges etwa 1.000 bis 2.000m
ü.NN liegt und allmählich (über eine Entfernung von
etwa 1.000km) nach Osten auf eine Höhe von 200 bis 300m ü.NN
abfällt.
Die durchschnittlichen
Jahres-Temperaturen im Bereich der Prärien weisen von West
nach Ost in Abhängigkeit von der Höhe ü.NN und von
Süd nach Nord ein starkes Gefälle auf. Im Süden reichen
die Prärien dicht an die Winterfeuchten Subtropen bzw. Sommerfeuchten
Tropen heran.
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
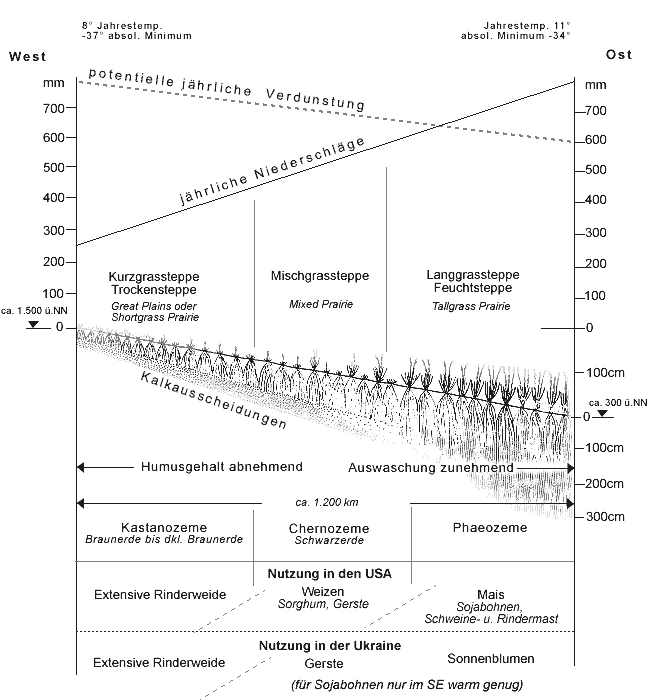 |
| |
|
| |
 Abb. B3-06:
Abb. B3-06:
"Schematischer
Schnitt durch das nach Westen von 300m NN ansteigende Präriegebiet
(Great Plains) mit Angaben über die Änderung des Klimas
(oben), der Vegetation (Mitte) und der Böden (unten)"
(nach
Walter
1968, S. 636, aus Walter
& Breckle, 1991, S. 347) und Schultz
(2000, S. 303).
|
| |
|
| |
Detaillierte
Angaben zu den oben genannten drei Böden - in der gleichen Reihenfolge
- siehe hier: |
| |
|
| |
|
| |
Die agrare
Nutzung der Kurzgras- und Langgrassteppengebiete in der Ukraine
und in N-Amerika nach Jätzold (1984), aus Schultz (2000,
S. 303).
"Die
gegenwärtigen Verbreitungsschwerpunkte des grossbetrieblichen
Getreidebaus lassen sich wie folgt umreissen:
- Nordamerika:
Der mittlere Westen vom nördlichen Texas über die Staaten
Kansas, (Ost-)Colorado, Nebraska, Nord- und Süd-Dakota und
Montana bis weit nach Kanada (Alberta, Saskatchewan) hinein; ausserdem
das Columbia Plateau in den Staaten Washington, Oregon und Idaho.
- Frühere
UdSSR: Die temperaten Steppengebiete östlich der Wolga
und insbesondere im südwestlichen Sibirien; westlich der
Wolga ist der Weizen zwar ebenfalls eine wichtige Verkaufsfrucht,
doch erfolgt sein Anbau dort meist auf gemischten Betrieben [...].
-
 In
diesen Verbreitungsschwerpunkten (inkl. weitaus kleinere Gebiete
in Argentinien und Australien) werden über 50% des Weltweizens
produziert ..." (Schultz 2002, S. 303/304) In
diesen Verbreitungsschwerpunkten (inkl. weitaus kleinere Gebiete
in Argentinien und Australien) werden über 50% des Weltweizens
produziert ..." (Schultz 2002, S. 303/304)
|
|
|
| |
|
 |
 Problemkreis
"US-Agrarpolitik" und "EU-Agrarpolitik": Die Subventionierung
von Agrarprodukten, Armut für die Dritte Welt" Problemkreis
"US-Agrarpolitik" und "EU-Agrarpolitik": Die Subventionierung
von Agrarprodukten, Armut für die Dritte Welt" |
| |
|
| |
|
| |
-
 Bedacht
werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem
aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema
"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)
- aber auch aus den USA, stark subventioniert
wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen
Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten
Länder (sogenannten Entwicklungsländern)
geworden ist. Bedacht
werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem
aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema
"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)
- aber auch aus den USA, stark subventioniert
wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen
Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten
Länder (sogenannten Entwicklungsländern)
geworden ist.
- Dies
betrifft übrigens nicht nur den Weizen, sondern auch Mais,
Baumwolle und z.B. Zuckerrohr.
Weizen und Mais werden mittlerweile in einigen Ländern Afrikas
als Importgut billiger verkauft als der heimisch angebaute ...
- Dazu
heisst es in einem SPIEGEL - Artikel (19/2007,
S. 122) "Not für die Welt - Die Agrarsubventionen
reicher Länder zerstören die Existenz afrikanischer
Bauern" und unter "Totale Schieflage",
dass die Produktions- und Exportsubventionen für landwirtschaftliche
Güter aller Industrienationen im Jahre 2004 insgesamt
349 Mrd. $ betrugen, dagegen die Landwirtschaftshilfe
der Industrieländer an afrikanische Staaten nur 1
Mrd. $ betrug (Quelle: OECD).
 Dazu
der Bauernpräsident Samba Guèye des Senegal in
dem gleichen Artikel (S.131): "Wenn die reichen Länder
jede Entwicklungschance in unseren Ländern zerstören,
dann müssen wir uns eben in ihren entwickeln (...) Wir
haben Erdnüsse exportiert, das wurde uns kaputtgemacht.
Wir exportierten Fisch, der wurde uns weggefangen. Nun exportieren
wir eben Menschen." Dazu
der Bauernpräsident Samba Guèye des Senegal in
dem gleichen Artikel (S.131): "Wenn die reichen Länder
jede Entwicklungschance in unseren Ländern zerstören,
dann müssen wir uns eben in ihren entwickeln (...) Wir
haben Erdnüsse exportiert, das wurde uns kaputtgemacht.
Wir exportierten Fisch, der wurde uns weggefangen. Nun exportieren
wir eben Menschen."
- Wegen
der aktuellen Subventionen für den Zuckerrohranbau in den
USA, zahlen die Verbraucher nahezu eine Milliarde Dollar mehr
als das Produkt auf dem Weltmarkt kosten würde (Pimm
& Jenkins 2005).
- Dazu
eine wichtige Bemerkung des Generalsekretärs der UNCTAD
 - United
Nations Conference on Trade and Development -
[date
of access: 30.09.04]
- United
Nations Conference on Trade and Development -
[date
of access: 30.09.04]
"Eigentlich sollte ein solcher
Ansatz [die Subventionierung der Landwirtschaft]
unsinnig erscheinen in einer Zeit, da
die wohlhabenden Volkswirtschaften beinahe eine Milliarde US-Dollar
pro Tag (sechsmal mehr, als sie an Auslandshilfe leisten)
ausgeben, um - wie sie sagen - ihre Kleinerzeuger zu unterstützen."
Aus dem Vortrag von Rubens Ricupero, Generalsekretär
der UNCTAD Genf, am 30. Juni 2003.
- Vgl.
Sie dazu:
 Grenzen
der Globalisierung - Ökonomie, Ökologie und Politik
in der Weltgesellschaft,
von
Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf (2002)
Grenzen
der Globalisierung - Ökonomie, Ökologie und Politik
in der Weltgesellschaft,
von
Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf (2002)
- und
 Perverse
Subsidies: How Misused Tax Dollars Harm the Environment and
the Economyy,
von Norman Myers und Jennifer Kent (2001), Island Press, USA. Perverse
Subsidies: How Misused Tax Dollars Harm the Environment and
the Economyy,
von Norman Myers und Jennifer Kent (2001), Island Press, USA.
Zum Inhalt
 empfohlen für Studenten etc., die sich für den Zusammenhang
von Politikgestaltung und Umweltfragen, besonders
in den Tropen, interessieren:
empfohlen für Studenten etc., die sich für den Zusammenhang
von Politikgestaltung und Umweltfragen, besonders
in den Tropen, interessieren:
- Untersuchung
der Rolle von Subventionen für "policymaking"
(Politikgestaltung)
- Quantifizierung
direkter Kosten widersinniger Subventionierung
- Untersuchung
der hauptsächlichen Subventionen für die Bereiche
Landwirtschaft, Energiewirtschaft, Transportwesen, Wasserwirtschaft,
Fischerei und Forstwirtschaft
- Darstellung
der Auswirkungen dieser Subventionen auf die Umwelt
- Lösungsvorschläge
für die Politik zur Vermeidung widersinniger Subventionen
|
|
|
| |
|
 |
 Problemkreis
"Wasserverbrauch
und Subventionierung in der Landwirtschaft - das
virtuelle Wasser" Problemkreis
"Wasserverbrauch
und Subventionierung in der Landwirtschaft - das
virtuelle Wasser" |
| |
|
| |
|
| |
- Bzgl.
 Wasserverbrauch
und Subventionierung in der Landwirtschaft ist folgende Information
von hoher Bedeutung:
Wasserverbrauch
und Subventionierung in der Landwirtschaft ist folgende Information
von hoher Bedeutung:
"um
1 t Weizen anzubauen, braucht man 1.000 t Wasser. ... Seit Ende
der 80er Jahre haben die Länder im Nahen Osten und in Nordafrika
jährlich 40 Mio. t Getreide und Mehl importiert. Es fliesst
also mehr  «virtuelles»
Wasser in
die Region, als ganz Ägypten für die Bewässerung
von Feldern aus dem Nil holt. ... «virtuelles»
Wasser in
die Region, als ganz Ägypten für die Bewässerung
von Feldern aus dem Nil holt. ...
«Virtuelles» Wasser ist nicht nur in Unmengen vorhanden,
es kostet auch erstaunlich wenig. Die Weizenpreise sind in den
letzten 100 Jahren stetig gefallen. Auf dem von den USA und der
EU beherrschten Markt für landwirtschaftliche Produkte wird
Weizen gegenwärtig für etwa die Hälfte der Produktionskosten
gehandelt."
Nach Prof. J. A. Allan, Wasserexperte am Institut für Orientalische
und Afrikanische Studien der Londoner Universität,  Schweizerische
UNESCO-Kommission. Schweizerische
UNESCO-Kommission.
[date
of access: 07.03.07, leider nicht mehr online]
 Diese
Vorgänge sollten vor dem Hintergrund gesehen werden, dass Diese
Vorgänge sollten vor dem Hintergrund gesehen werden, dass
- sich
innerhalb der letzten 70 Jahre der
 Wasserverbrauch
weltweit versechsfacht hat, Wasserverbrauch
weltweit versechsfacht hat,
- in
den USA mehr Grundwasser entnommen wird als "die
Natur" nachliefert,
- Hier
einige Bemerkungen zu den Problemfeldern
|
|
|
| |
|
 |
 Problemkreis
"sogenannte regenerative Energien - Der
Biokraftstoff vom Feld" Problemkreis
"sogenannte regenerative Energien - Der
Biokraftstoff vom Feld" |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 Weitere
Hinweise zur Bedeutung von Agrarsubventionen in den Industrieländern
und der Biopiraterie für LDCs (Low Developed Countries) finden
Sie hier: Weitere
Hinweise zur Bedeutung von Agrarsubventionen in den Industrieländern
und der Biopiraterie für LDCs (Low Developed Countries) finden
Sie hier:
-
 attac attac
- Ein Artikel
in DIE ZEIT von Christian Tenbrock und Wolfgang Uchatius zum Thema:
Gibst du mir, nehm ich dir - Der Krieg behindert eine gerechte
Globalisierung: Im Welthandel sucht der Norden nur noch seinen
Vorteil.
- Der Film
"Septemberweizen" (1980) von Peter Krieg wurde
nach Erscheinen als linkes Propaganda-Machwerk diffamiert und
später mit dem Adolf-Grimme-Preis als bester Dokumentarfilm
ausgezeichnet. Mittlerweile zeigt sich immer mehr, wie zutreffend
die Aussagen dieser Dokumentation waren.
- "Der
in sieben Kapitel unterteilte "Septemberweizen"
forscht am Beispiel eines Nahrungsmittels nach den Ursachen
des Hungers - in den reichen Ländern der ersten wie in
den armen Ländern der Dritten Welt - in einer Zeit des
Überflusses und fragt, durch welche Praktiken Weizen
zu einer Ware und Waffe werden kann."
 ID
Kolchose ID
Kolchose
- Dazu: Causes
of Poverty -
 Structural
Adjustment—a Major Cause of Poverty Structural
Adjustment—a Major Cause of Poverty
- "Many
developing nations are in debt and poverty partly due to the
policies of international institutions such as the International
Monetary Fund (IMF) and the World Bank. - Their programs have
been heavily criticized for many years for resulting in poverty.
In addition, for developing or third world countries, there
has been an increased dependency on the richer nations. This
is despite the IMF and World Bank’s claim that they will
reduce poverty."
-
 Wem
gehört der Reis? Wem
gehört der Reis?
Zur Biopiraterie. Untersuchung gefördert von der
Stadt Münster mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
NRW.
[aktualisiert am 17.04.08, einige Beiträge sind mittlerweile
offline]
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Kurzgras-,
Mixed- und Langgras-Prärie |
| |
|
| |
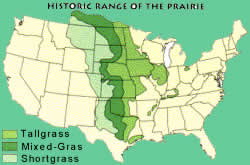
 Abb. B3-07:
Abb. B3-07:
Verschiedene Prärie-Typen.
Wie oben bereits
angedeutet, wird die Prärie in die Kurzgras-Prairie
(Short Grass Prairie als die trockenste Ausbildung der Steppenlandschaft
im Osten und die Langgras-Prärie (Tall Grass Prairie)
im Westen eingeteilt.
Dazwischen liegt die sogenannte "Gemischte Prärie"
bzw. Mixed Grass Prairie. Wegen der hohen Variabilität
der Niederschlagshöhe und der Niederschlagsverteilung (vgl.
Bemerkungen oben!), sind die Grenzen zwischen den Prärietypen
niemals scharf und starr, sondern zeigen jährlich ein starkes
Hin- und Herwandern innerhalb der Mischzone zwischen trockener und
feuchter Prärie.
Copyright für die Abb. bei  IDNR
[Alle Links aktualisiert am 30.09.04] IDNR
[Alle Links aktualisiert am 30.09.04]
|
| |
|
| |
|
| |
 "Prairies-
these are the grasslands in North America. "Prairies-
these are the grasslands in North America.
Because Rainfall decreases toward the west, the prairies are different.
In the east, which gets as much as 40 inches of rain per year, tall
grass prairie once grew. True prairie areas have tall grass dotted
with colorful wildflowers. Grasses are shorter as you move west
toward the central prairies and the dry Great Plains. In most of
the prairies, trees and shrubs grow along riverbanks and streams.
Grass fires are fairly common in the summer. Prairies once
covered the Midwest, but little natural vegetation is left. It
was plowed for agricultural purposes."
 Abb. B3-08:
Abb. B3-08:
Weizenfelder
in Saskatchewan, Kanada
(Quelle  http://www.educeth.ch),
Source: http://www.educeth.ch),
Source:  http://www.cbhs.org/jharris/WG_CH2_Sect2.doc http://www.cbhs.org/jharris/WG_CH2_Sect2.doc
|
| |
|
| |
 Die
thermo-hygrischen Bedingungen der Prärien spiegeln sich
in der Zusammensetzung der Lebensformen und speziell in der
Ausbildung der Wurzelsysteme zur Sicherung der Wasserversorgung.
Intensive Untersuchungen dazu wurden in der nordamerikanischen Prärie
sehr früh von John
Ernest Weaver (weitere Die
thermo-hygrischen Bedingungen der Prärien spiegeln sich
in der Zusammensetzung der Lebensformen und speziell in der
Ausbildung der Wurzelsysteme zur Sicherung der Wasserversorgung.
Intensive Untersuchungen dazu wurden in der nordamerikanischen Prärie
sehr früh von John
Ernest Weaver (weitere  Publikationen)
durchgeführt. Publikationen)
durchgeführt.
[Alle
Links aktualisiert am 30.09.04, mittlerweile weitgehend offline]
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 Tab. B3-01:
Tab. B3-01:
Wurzeltiefe und Halmhöhe bei Weizen
in der nordamerikanischen Prärie bei abnehmenden Niederschlägen
(nach
Weaver, aus Walter 1968, Tab. 105, S. 643) |
| |
|
| |
| Vegetationszone |
Niederschlagshöhe |
Wurzeltiefe
Ø |
Halmhöhe
Ø |
| Langgrasprärie |
660-815mm |
160cm |
100cm |
| Gemischte
Prärie |
535-610mm |
130cm |
95cm |
| Kurzgrasprärie |
405-485mm |
75cm |
65cm |
|
| |
|
| |
J.E.
WEAVER "fand, dass von 43 Charakterarten der Prärie 14%
nur in den oberen 60cm wurzeln; bei 21% erreicht das Wurzelsystem
150cm, während die restlichen 65% noch tiefer (250 - 350cm) gehen
[...]; sie dringen sogar bis 600cm in die Tiefe vor." (Walter
1968, S.642) |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 Abb. B3-09:
Abb. B3-09:
Wurzelsysteme der Präriepflanzen (nach
J.E. Weaver aus Walter 1968, Abb. 465, S. 642) [Alle
Links aktualisiert am 19.01.12, mittlerweile tw offline]
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Artenlisten: |
| |
|
| |
[Alle
Links aktualisiert am 19.01.12]
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Bodenverbreitung
und Bodentypen: |
| |
|
| |
Auf die Böden
N-Amerikas, speziell der Prärien, kann hier nur generell
eingegangen werden. Ist ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt
auch hier detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen.
Vorläufig werden die Hauptbodentypen vorgestellt und auf umfangreiches
Material im Internet hingewiesen.
|
| |
|
| |
Wiederholung
der wichtigsten Bodentypen (nach
versch. Systematiken) - Die
deutschen und FAO-Bezeichnungen für Prärieböden wurden
in der kombinierten Abb. aus Schultz
und Walter eingetragen. |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
 Tab. B3-02:
Tab. B3-02:
Die wichtigsten Bodentypen nach versch. Systematiken. [Alle
Links aktualisiert am 30.09.04] |
| |
|
| |
| Deutsche
Systematik |
FAO-System |
Soil
Taxonomy (USA) |
Klima/Vegetation |
Buroseme
(russ. - subboreal)
(brauner Halbwüstenboden)
Sierozeme (russ. - subtrop. Halbwüstengebiete)
Grauerden |
Xerosols
oder
(Haplic) Calcisols
|
Mollic
Aridisols
oder
Xeralf |
Wüstenböden
mit arid-moderat, kalter Winter,
heisser Sommer, kontinental,
Wüste
bis Steppe, gemischte Prärie
"Deutliche Bodenzonierung in Phaeozem,
Chernozem und Kastanozem als Leittypen, die in
der Sowietunion von Nord nach Süd, in Nord- und Südamerika
von Ost nach West zu beobachten ist und mit der eine ausgeprägte
Vegetationszonierung einhergeht."
(aus Scheffer
& Schachtschabel 1992, S. 457)
|
| Podsole
(russ.), Bleich- oder Aschenböden |
Podzols
s.l. |
Spodosols
s.l.
Karte
der Spodosols
in den USA |
Schwarzerde
bzw. Tschernosem, ein humusreicher Bodentyp mit einem
A-C-Profil, der
sich aus Löss entwickelt hat
typischer Boden der Langgrassteppe
|
Chernozems
vgl. Sie unten! |
Mollisols
(frigid Borolls and Ustolls)
Karte
der Mollisols
in den USA
Beispiel-Profil
|
Kastanozeme
kastanienfarbener
Steppenboden
(im Mull-A-Hirizont brauner als Tschernozeme)
typischer Boden der Kurzgrassteppe |
Kastanozems
vgl. Sie unten! |
Ustolls
(Mollisols)
bis
Ustalfs
(Karte
der Alfisols) |
Degrad.
(verbraunte, lessivierte) Tschernoseme
Nach Schultz (2000, S. 280) typischer
Boden des Waldes und der Waldsteppe |
Phaeozems
vgl. Sie unten!
calcari-stagnic
Phaeozem |
Udolls
(Mollisols) |
Nach
Walter & Breckle (1991) sowie Scheffer & Schachtschabel
(1992) jedoch Typischer Prärieboden (!) der USA
und der argentinischen
Pampa (!)
Nach
Wörterbuch der Bodenkunde, G. Hintermaier-Erhard &
W. Zech, Enke Verlag, p. 269,
typischer Boden der Waldsteppe
|
| Kastanien
- Braunerde |
Cambisols
s.l. |
Inceptisol
s.l.
(arid environment)
Cambic
Inseptisol |
Prärie |
Parabraunerde
|
Luvisols
oder
Acrisols |
Alfisols
s.l.
oder
Ultisols |
Prärie |
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Drei
wichtige Bodentypen und -profile: |
| |
|
| |
 |
 |
 |
|
Kastanozem
Kurzgrassteppe
N
= 350 - 250 mm/a
T = 5 - 9 °C
|
Chernozem
Langgrassteppe
N
= 600 - 300 mm/a
T = 6 - 10 °C
|
Phaeozem
Waldsteppe
N
= 650 - 500 mm/a
T = 5 - 7 °C
|
|
| |
 Abb. B3-10:
Abb. B3-10:
Die zonalen Böden der kühlen
und kühl-trockenen Klimate
( www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html,
akt. am 21.03.04, leider mittlerweile offline, copyright der Abbildungen
bei Uni Zürich - hier sehr ausführliche Beschreibung der
o.g. Böden zur Herkunft ihrer Namen, zur Genese, Verbreitung
mit Karten und Nutzungsmöglichkeiten!)
www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html,
akt. am 21.03.04, leider mittlerweile offline, copyright der Abbildungen
bei Uni Zürich - hier sehr ausführliche Beschreibung der
o.g. Böden zur Herkunft ihrer Namen, zur Genese, Verbreitung
mit Karten und Nutzungsmöglichkeiten!) |
 |
|
 |
 |
| |
|
 |
 Phaeozem:
(in der Regel degradierte - verbraunte, lessivierte
- Chernozeme)
Phaeozem:
(in der Regel degradierte - verbraunte, lessivierte
- Chernozeme)
- "Typisch
ist ein humusreicher Horizont, der kalkfrei ist (im
Gegensatz zu den Chernozems), jedoch eine Basensättigung
von über 50 % (oft bis 100 %) aufweist. Die pH-Werte betragen
5-7.5. Phaeozems weisen eine sehr hohe biologische Aktivität
auf. Dies führt zu einem homogenen, dunklen Horizont mit
intensiver Durchwurzelung. Der humusreiche Horizont ist meist
etwas weniger mächtig als bei einem Chernozem.
Verbreitung in semiariden Klimaten. Phaeozems sind typische
Vertreter der Waldsteppe und finden sich teilweise unter den Prärieböden
Nordamerikas, der Pampa Argentiniens und in der südlichen
GUS, jedoch auch in den Hochländern der Tropen. In Europa
finden sich kleine Gebiete in der ungarischen Donauregion. In
der Schweiz existieren Phaeozeme im Unterengadin bei Susch.
Grundsätzlich finden sich Phaeozems angrenzend an Tschernosems
in den etwas feuchteren Bereichen.
|
 |
 |
| |
|
 |
Chernozem:
(in der Regel Böden mit mächtigem schwarzen
Mullhorizont)
- Chernozems
zeichnen sich durch einen mächtigen und humusreichen (bis
16 %) Ah-Horizont aus. Unter dem Ah-Horizont steigt der pH-Wert
bis zur Karbonatgrenze hin an, so dass es im oberen Teil des C-Horizontes
zu konkretionären Kalkausscheidungen in Form von Schlieren
und Flecken aber auch Lösskindeln kommt. Im Gegensatz zu
den Kastanozems existiert kein Horizont mit sekundären Gipsausscheidungen.
Verbreitung: Chernozems finden sich grossflächig in
Steppengebieten, wo der Niederschlag nicht für eine vollständige
Profildurchwaschung ausreicht. In Zentralasien und Nordamerika
grenzen sie oft an Gebiete mit Phaeozems an, sind jedoch in Südamerika
nicht verbreitet.
|
 |
 |
| |
|
| |
Kastanozem:
(in der Regel Böden mit mächtigem braunen Mullhorizont
- "kastanienfarben")
- Aufgrund
der geringeren Produktion der Kurzgrassteppe in den warm-trockenen
Klimazone und der weniger intensiven Durchwurzelung weisen Kastanozems
im Vergleich mit Chernozems und Phaeozems einen etwas weniger
mächtigen Ah-Horizont mit geringeren Humusgehalten (2 - 4
%) auf. Die Bodenfarbe ist dadurch eher grau-braun als schwärzlich
wie bei den Chernozems. Durch die etwas milderen Winter ist die
Bioturbation weniger intensiv und reicht nicht in die extreme
Bodentiefe wie bei den Chernosems. Krotovinen sind dadurch seltener
zu finden.
Grundsätzlich grenzen Kastanosems an die trockenen Bereiche
der Chernozems an. Sie bedecken grosse Flächen der eurasischen
Kurzgrassteppe bis in die Zentralmongolei, der nordamerikanische
Prärie sowie der südamerikanischen Pampa.Bei weiter
steigenden Temperaturen setzt der Übergang zu den Halbwüstenböden
ein."
|
| |
Beschreibung
der drei Böden aus:
www. source: http://www.geo.unizh.ch/bodenkunde/kapitel/steppen.html
(akt. am 21.03.04, Quelle mittlerweile
offline) |
| |
|
| |
|
 |
Infos
zur Taxonomie und Verbreitung von Böden in den Trockenen Mittelbreiten: |
| |
|
| |
- Bodentypenkarte
der USA (nach der Bodenkarte des USDA)
in Walter & Breckle (1991), S. 346
-
 US-Soilmap
with Dominant Soil Orders US-Soilmap
with Dominant Soil Orders
-
 Prairie
Soils: The case for conservation Prairie
Soils: The case for conservation
-
 Basic
Soil Science Webpage of the University of Minnesota Basic
Soil Science Webpage of the University of Minnesota
-
 Soils
of Arid Regions of the United States and Israel Soils
of Arid Regions of the United States and Israel
-
 Soils
and vegetation of the prairie Soils
and vegetation of the prairie
-
 World
Soil Resources der FAO World
Soil Resources der FAO
-
 WIN-PST
Soils Modules zum Downloaden WIN-PST
Soils Modules zum Downloaden
-
 United
States Department of Agriculture (USDA) - unter Search:
prairie soils eingeben! United
States Department of Agriculture (USDA) - unter Search:
prairie soils eingeben!
-
 Distribution
Maps of dominant Soil Orders by USDA - Natural Resources Conservation
Services (incl. Profiles) Distribution
Maps of dominant Soil Orders by USDA - Natural Resources Conservation
Services (incl. Profiles)
-
 Die
zonalen Böden der kühlen und kühl-trockenen Klimate:
Phaeozems, Kastanozems, Chernozems (siehe auch Die
zonalen Böden der kühlen und kühl-trockenen Klimate:
Phaeozems, Kastanozems, Chernozems (siehe auch  !)
!)
[Alle
Links aktualisiert am 30.09.04, leider mittlerweile offline]
|
| |
 Hier finden Sie umfangreiche
Infos zur Bodengeografie und Bodenkunde sowie Systematik der Böden
Hier finden Sie umfangreiche
Infos zur Bodengeografie und Bodenkunde sowie Systematik der Böden |
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Badlands
und Dust Bowls: |
| |
|
| |
Weite Bereiche
der nördlichen Mischgrassteppe der Prärie gehören
zu den Badlands (vgl. Abb. Steppenökosysteme
in N-Amerika). Eine ausführliche Beschreibung zur Geschichte
und Bedeutung
dieser Landschaft. [date
of access: 19.01.12]
Bedeutung
dieser Landschaft. [date
of access: 19.01.12]
Die Badlands
(nomen est omen) sind extrem gestörte, besonders erodierte
Landschaften, oft als Folge überhöhter Nutzung. Schädigung
und Zerstörung der bodenschützenden Vegetation durch Ackerbau
oder übermässigen Viehtritt. Dies hat hier zu verheerenden
Overland Flows mit einerseits tiefen Zerschneidungen der
Landschaft und flächenhaften Bodenabtragungen geführt.
Kilometerlange Erosionsschluchten in morphologisch weichen Lockersedimenten
(in Steppengebieten Zentralasiens mehrere hundert Meter tief in
den Lössgebieten!) machen die Gebiete für die Landwirtschaft
und teilweise sogar als Weideflächen unbrauchbar.
Besonders betroffen
sind bzw. waren die Great Plains zwischen dem Fuss der Rocky
Mountains und dem Missouri und die Staaten Nord- und Süd-Dakota,
Nebraska, Kansas, Oklahoma und Texas (nach
Mensching 1990, S. 67).
"Die Zerstörung
der Vegetationsdecke bei einem durch Starkregen gekennzeichneten
semiariden Klima und die nicht angepassten Nutzungsmethoden sowohl
in der Tierhaltung als auch beim Weizenanbau, z.T. mit Dry-Farming-Feldern,
bringen solche Badland-Formen verstärkt hervor" (Mensching,
ibid). Der von Mensching verwendete Begriff "Desertifikation"
wird von Schultz (2000, S. 413/414)
und von Müller-Hohenstein (1993, zit.
von Schultz) für derartige Landdegradationen abgelehnt,
da es sich hier nicht um einen Prozess handelt, bei dem tatsächlich
eine Wüste entsteht. Tatsächlich regenerieren solche Landschaften
sehr schnell (wie dies übrigens vom Verfasser dieser Seiten
auch in den Savannenlandschaften Madagaskars beobachtet wurde),
wenn in den betroffenen Gebieten die übermässige Nutzung
eingestellt wird.
 Zu
den ökologischen Folgen der Weidewirtschaft und grossflächigen
Tierhaltung schreibt Zu
den ökologischen Folgen der Weidewirtschaft und grossflächigen
Tierhaltung schreibt  D.
Pimentel (1997) von der Cornell University: D.
Pimentel (1997) von der Cornell University:
- Livestock
is directly or indirectly responsible for much of the soil erosion
in many countries.
- On U.S.
lands where grain feed is produced, soil loss averages 13 tons
per hectare/a.
- Due to the
vegetation cover pasture lands are eroding at a lower space, at
an average of 6 tons/a.
- But erosion
may exceed 100 tons on severely overgrazed pastures, and 54% of
U.S. pasture land is being overgrazed
  Zu
den weitreichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
dieser verfehlten Weide- und Landwirtschaft (inkl. Industrialisierung
der Landwirtschaft) nach extremen Dürrejahren und Missernten
zu Beginn der 1930er Jahre finden Sie in John
Steinbecks gesellschaftskritischen Roman "Früchte
des Zorns" (1939) viele Hinweise. Zu
den weitreichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen
dieser verfehlten Weide- und Landwirtschaft (inkl. Industrialisierung
der Landwirtschaft) nach extremen Dürrejahren und Missernten
zu Beginn der 1930er Jahre finden Sie in John
Steinbecks gesellschaftskritischen Roman "Früchte
des Zorns" (1939) viele Hinweise.
Ursache der
ausgeprägten Dürrejahre waren übrigens Klima-Anomalien
im Südpazifik, heute bekannt als das  El
Niño - Phänomen, welches sich auf weite Bereiche
des mittleren Westens der USA auswirkte, die Landschaften austrocknen
und zur "Staubschüssel", eben "dust bowl",
werden liess. El
Niño - Phänomen, welches sich auf weite Bereiche
des mittleren Westens der USA auswirkte, die Landschaften austrocknen
und zur "Staubschüssel", eben "dust bowl",
werden liess.
 Abb. B3-11 (rechts):
Abb. B3-11 (rechts):
Badlands
[URL:
http://www.auswandern.us/badlands.html
; date
of access: 25.03.04]
Neben Erosionen
durch heftige Regelfälle, treten wegen der Vegetationsdegradation
auch Auswehungen des Oberbodens auf, so dass es oft zu grossflächigen
Sandstürmen (Dust Bowls vgl.
Abb. links!) mit verheerenden Auswirkungen kommen kann.
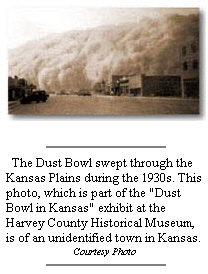 Z.B.
sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"
in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.
Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt
sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000
Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."
(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,
S. 69). Z.B.
sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"
in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.
Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt
sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000
Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."
(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,
S. 69).
Zusammenfassend
kann gesagt werden, dass die schweren Degradationen die Folge von
Missmanagement im Trockengebiet sowohl im Regenfeldbau als
auch im Bewässerungsfeldbau waren. "Als Folge dieser Degradation
schätzt man einen Abtrag von "4,8 tons per acre in Nebraska"
sowie von 14,0 tons per acre durch Winderosion" (aus
Mensching 1990, S. 69).
 Abb. B3-12:
Abb. B3-12:
Dust Bowl (Dust storm approaching
Stratford, Texas Dust bowl surveying in Texas Image ID: theb1366,
Historic C&GS Collection, Location: Stratford, Texas, Photo
date: April 18, 1935, Credit: NOAA George E. Marsh Album)
[date
of access: 25.03.04, Beitrag mittlerweile offline]
Gegenmassnahmen waren:
- Soil Conservation
Act 1935
- Bildung
des Soil Conservation Service 1935
- Gründung
des Civil Conservation Corps
- Entwicklung
des Conservation Reserve Program
sowie
- No Tillage
- Contour
Ploughing
- Wind Breaks
- Strip Cropping
|
 |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
Aktuelle
& historische Nutzung, Flora, Vegetation, Fauna und Naturschutz: |
| |
|
| |
-
 Bison grazing patterns on seasonally burned tallgrass prairie
Bison grazing patterns on seasonally burned tallgrass prairie

-
 Vegetation of Wisconsin,
Vegetation of Wisconsin,  sehr umfangreiches Material zu allem, was mit Prärie zu
tun hat, von Virginia Kline (UW-Madison Botany Department
Photo Collection by Dr. Virginia Kline, Emeritus Ecologist-UW
Arboretum)
sehr umfangreiches Material zu allem, was mit Prärie zu
tun hat, von Virginia Kline (UW-Madison Botany Department
Photo Collection by Dr. Virginia Kline, Emeritus Ecologist-UW
Arboretum)
-
 50 Years of Change in Illinois Hill Prairies by Kenneth R. Robertson,
Mark W. Schwartz, Jeffrey W. Olson, Brian K. Dunphy, and H. David
Clarke - Center for Biodiversity - Illinois Natural History Survey
50 Years of Change in Illinois Hill Prairies by Kenneth R. Robertson,
Mark W. Schwartz, Jeffrey W. Olson, Brian K. Dunphy, and H. David
Clarke - Center for Biodiversity - Illinois Natural History Survey
-
 University
of Wisconsin - Prairie Restoration Campus Resources, Books/Background
Reading
University
of Wisconsin - Prairie Restoration Campus Resources, Books/Background
Reading
-
 The
Tallgrass Prairie - Prairie Restoration The
Tallgrass Prairie - Prairie Restoration
[Alle Links aktualisiert am 19.01.12, tw mittlerweile offline]
|
| |
|
| |
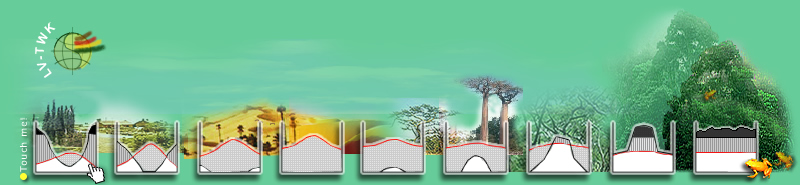



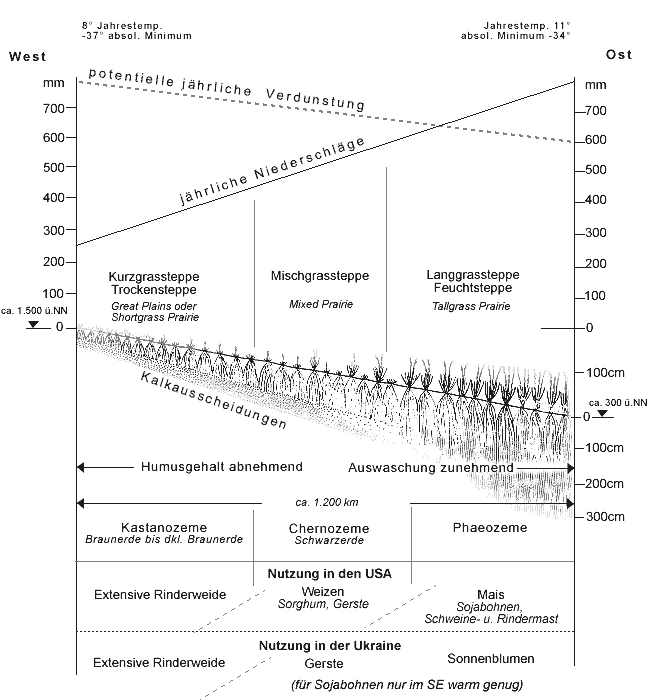










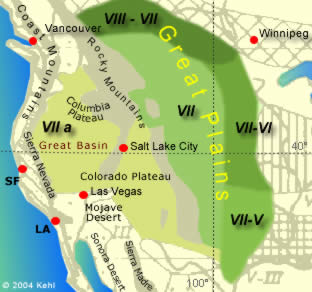
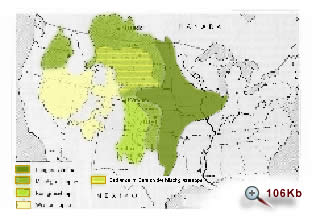
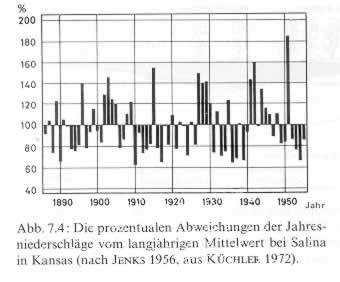 Wesentliches
Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains
mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.
Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu
Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden
verantwortlich.
Wesentliches
Merkmal der Prärien Nordamerikas ist die, von den Rocky Mountains
mit ihrer Nord-Süd-Erstreckung gesteuerte, Niederschlagsverteilung.
Die jährliche Niederschlagshöhe variiert von Jahr zu
Jahr sehr stark und ist für charakteristische Trockenperioden
verantwortlich.  Bedacht
werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem
aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema
"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)
- aber auch aus den USA, stark subventioniert
wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen
Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten
Länder (sogenannten Entwicklungsländern)
geworden ist.
Bedacht
werden muss, dass der Anbau sowie der Export von Weizen, vor allem
aus der Europäischen Union (vgl. unten unter Thema
"US-Agrarpolitik" - betr. aber auch die EU-Agrarpolitik)
- aber auch aus den USA, stark subventioniert
wird und damit zu einer existenzbedrohenden Belastung der agrarischen
Produktion in Schwellenländern sowie der weniger entwickelten
Länder (sogenannten Entwicklungsländern)
geworden ist. 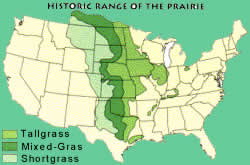
 "Prairies-
these are the grasslands in North America.
"Prairies-
these are the grasslands in North America. 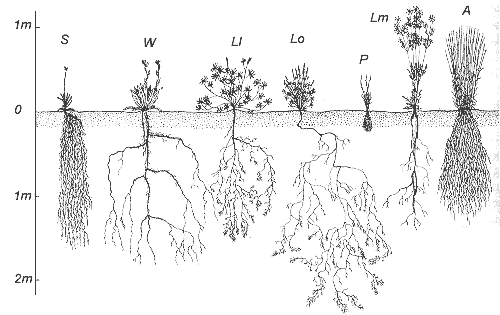




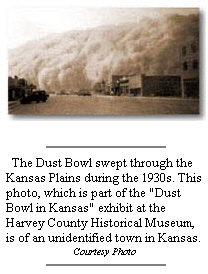 Z.B.
sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"
in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.
Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt
sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000
Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."
(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,
S. 69).
Z.B.
sind die 1930er Jahre (1931-1936) als "dust bowl years"
in die Geschichte eingegangen. Während des Sandsturms vom 11.
Mai 1934 wehten 11 Mio. Tonnen Staub über Chicago hinweg. Insgesamt
sollen 3,6 Mio. ha Ackerland zerstört worden sein. Etwa "650.000
Farmer mit 400.000km² Landbesitz [wurden] als ruiniert gemeldet."
(nach Schmieder 1963, aus Mensching 1990,
S. 69). 
