| |
|
|
|
|
 |
Extremwüste
Sahara - Beispiele für Marslandschaften auf
der Erde |
| |
|
| |
 Die
Sahara im Osten Nordafrikas,
genannt 'Libysche Wüste' oder
'Western Desert of Egypt', ist eines der
trockensten Gebiete der Erde. Die
Sahara im Osten Nordafrikas,
genannt 'Libysche Wüste' oder
'Western Desert of Egypt', ist eines der
trockensten Gebiete der Erde.
Es
wird geprägt von Gebirgs- bzw.  Steinwüsten
(Hammada), Steinwüsten
(Hammada),  Kieswüsten
(Serir) und Kieswüsten
(Serir) und  Sandwüsten
(Erg), die den kleinsten Teil bedecken (für
die gesamte Sahara etwa 20%). Ihr fast regenloser
Kern liegt im südwestlichen Bereich der "Western
Desert" Ägyptens. Dieser zentrale Teil
der Sahara ist wegen seiner extrem schweren Zugänglichkeit
erst relativ spät ins Blickfeld der wissenschaftlichen
Forschung geraten. Die dort vorherrschenden Landschaftsformen
dienten der NASA
zur Vorbereitung ihrer Marsmissionen. Sandwüsten
(Erg), die den kleinsten Teil bedecken (für
die gesamte Sahara etwa 20%). Ihr fast regenloser
Kern liegt im südwestlichen Bereich der "Western
Desert" Ägyptens. Dieser zentrale Teil
der Sahara ist wegen seiner extrem schweren Zugänglichkeit
erst relativ spät ins Blickfeld der wissenschaftlichen
Forschung geraten. Die dort vorherrschenden Landschaftsformen
dienten der NASA
zur Vorbereitung ihrer Marsmissionen.
 Abb.
D2-10/01 (rechts): Abb.
D2-10/01 (rechts):
Nordöstlicher  Gilf
Kebir mit dem Gilf
Kebir mit dem  'Contrast
Wadi' - Blick nach NO. 'Contrast
Wadi' - Blick nach NO.
Erste
konkrete Vorstellungen von der Wüste,
speziell der Sahara, wurden wesentlich
geprägt von Expeditionsberichten des 19.
Jahrhunderts (siehe unten!). Diese Berichte stellten
die Basis dar für alle weiteren wissenschaftlichen
Untersuchungen.
Nicht
vergessen werden darf in diesem Zusammenhang auch
der ungarische Wüstenforscher  László
Ede Almásy (1895-1951). Sein Name
gelangte wieder in das öffentliche Bewusstsein
- romantisch verklärt - durch den Hollywood-Film László
Ede Almásy (1895-1951). Sein Name
gelangte wieder in das öffentliche Bewusstsein
- romantisch verklärt - durch den Hollywood-Film
 "Der
englische Patient". In den 20er und 30er
Jahren unternahm er mehrere Expeditionen in die
Libysche Wüste mit Kaftfahrzeugen, aber auch
mit einem Leichtflugzeug. Er besuchte mehrmals
die Region um Uweinat und den "Der
englische Patient". In den 20er und 30er
Jahren unternahm er mehrere Expeditionen in die
Libysche Wüste mit Kaftfahrzeugen, aber auch
mit einem Leichtflugzeug. Er besuchte mehrmals
die Region um Uweinat und den  Gilf
Kebir (Gilf el-Kebir), von dem er die ersten
Karten anfertigte (u.a. wurden von ihm Akazienbestände
erwähnt, Török,
Z., 1997), und wo er 1933 auch prähistorische
Felsbilder, z.B. Gilf
Kebir (Gilf el-Kebir), von dem er die ersten
Karten anfertigte (u.a. wurden von ihm Akazienbestände
erwähnt, Török,
Z., 1997), und wo er 1933 auch prähistorische
Felsbilder, z.B. "Die
Schwimmer" entdeckte [date
of access: 04.12.11]. Almásy
publizierte mehrere
Bücher über seine Expeditionen.
"Die
Schwimmer" entdeckte [date
of access: 04.12.11]. Almásy
publizierte mehrere
Bücher über seine Expeditionen.
Daneben
entstand auch ein verklärtes Bild von
der Wüste, ein Mythos, der sich wohl
belletristisch am stärksten durch Antoine
de Saint-Exupérys "Der Kleine Prinz"
verbreitete. (Saint-Exupéry,
A. de 1943: "Le Petit Prince".- New
York. / Saint-Exupéry,
A. de 2000:
"Der
Kleine Prinz", 56. Aufl. - Karl-Rauch-Verlag,
Düsseldorf). 1935 stürzte Saint-Exupéry
mit seinem Flugzeug zusammen mit dem Mechaniker
Prévot über der ägyptischen Wüste
ab und wurde nach 5 Tagen von einer Nomadenkarawane
gefunden. Leseprobe:
"Ich
blieb [...] allein [...], bis ich vor sechs
Jahren einmal eine Panne in der Wüste
Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt
gegangen. Und da ich weder einen Mechaniker
noch Passagiere bei mir hatte, machte ich
mich ganz allein an die schwierige Reparatur.
Es war für mich eine Frage auf Leben
und Tod. Ich hatte für kaum acht Tage
Trinkwasser mit.
Am
ersten Tag bin ich also im Sand eingeschlafen,
tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend
entfernt. Ich war viel verlassener als ein
Schiffbrüchiger auf einem Floss mitten
im Ozean. Ihr könnt euch daher meine
Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch
eine kleine seltsame Stimme mich weckte:
'Bitte ... zeichne mir ein Schaf!' - 'Wie
bitte?' - 'Zeichne mir ein Schaf ...' - Ich
bin auf die Füsse gesprungen, als wäre
der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die
Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah
ich ein kleines, höchst ungewöhnliches
Männchen, das mich ernsthaft betrachtete.
(S.9f) [Es war der Kleine Prinz] ...
Er
war müde. Er setzte sich. Ich setzte
mich neben ihn. Und nach einem Schweigen sagte
er noch: 'Die Sterne sind schön, weil
sie an eine Blume erinneren, die man nicht
sieht ...'
Ich
antwortete: 'Gewiss', und betrachtete schweigend
die Falten des Sandes unter dem Mond. 'Die
Wüste ist schön', fügte er
hinzu.
Und
das ist wahr. Ich habe die Wüste immer
geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne.
Man sieht nichts. Man hört nichts. Und
währenddessen strahlt etwas in der Stille.
'Es
macht die Wüste schön', sagte der
Kleine Prinz, 'dass sie irgendwo einen Brunnen
birgt.' Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle
Leuchten plötzlich zu verstehen."
(S.76f)
Textausschnitt
übernommen aus: Herbert
Popp (2001) Die Wahrnehmung der Sahara - Stereotype
über eine Wüstenregion und ihre touristische
Vermarktung.- Praxis Geographie, Juli-August 7/8:
4-9.
|
| |
|
| |
|
 |
Die
Sahara wird von der Wissenschaft 'entdeckt' |
| |
|
| |
  Bereits
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Flora NW-Afrikas
von dem schwedischen Naturforscher Pehr Forsskål,
eines Schülers Carl von Linnés, auf
seiner "Arabischen Reise" (1761-1769)
intensiv untersucht und in der "Flora
Aegyptiaco-Arabica" (1775) beschrieben.
Viele Taxa dieses Raumes sind daher mit seinem
Namen verbunden (vgl. Bereits
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Flora NW-Afrikas
von dem schwedischen Naturforscher Pehr Forsskål,
eines Schülers Carl von Linnés, auf
seiner "Arabischen Reise" (1761-1769)
intensiv untersucht und in der "Flora
Aegyptiaco-Arabica" (1775) beschrieben.
Viele Taxa dieses Raumes sind daher mit seinem
Namen verbunden (vgl.  Artenliste). Artenliste).
Detaillierte
geografische und floristische Kenntnisse über
die Libysche Wüste erbrachte die mehrmonatige,
von Gerhard
Rohlfs (1831–1896) geführte Expedition,
in die bisher weitgehend unbekannten Landschaften
südlich der Qattara-Depression.
Zu den Teilnehmern der damals mit Kamelen und
teilweise zu Fuss durchgeführten Unternehmung
gehörte auch der verdienstvolle Berliner
Botaniker Paul Friedrich August Ascherson(1834
–1913). Als Kustos am Berliner Botanischen
Museum widmete er sich vor allem der Botanik und
der speziellen Pflanzengeografie.
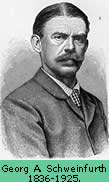 Während
der Expedition"wurde die Kleine Während
der Expedition"wurde die Kleine  Oase
[Dakhla] aufgenommen– 1875 veröffentlichte
Ascherson[in dem Expeditionsbericht]
die erste exakte Karte dieses Gebiets – und
die Oasen Dachel [Dakhla], Farafrah und Baharije
erkundet. 1887 veröffentlichte er in einem
Vorbericht
die botanischenErgebnisse der Expedition in der
Botanischen Zeitung. Oase
[Dakhla] aufgenommen– 1875 veröffentlichte
Ascherson[in dem Expeditionsbericht]
die erste exakte Karte dieses Gebiets – und
die Oasen Dachel [Dakhla], Farafrah und Baharije
erkundet. 1887 veröffentlichte er in einem
Vorbericht
die botanischenErgebnisse der Expedition in der
Botanischen Zeitung.
[Zehn
Jahre nach der Expedition mit dem Afrikaforscher
Rohlfs, im Jahre]1876 leitete er gemeinsam
mit dem Naturwissenschaftler Georg August Schweinfurth
(1836–1925) eine Expedition in die ägyptische
Thomaswüste; beide verfassten als Ergebnis
dieser Reise die »Illustrations de la flore
d'Egypte«, die 1887 und 1889 in Kairo herauskamen."
(Fischer
1998: 54/55)
|
| |
|
 |
Beginn
der ökologischen Forschung in der Wüste |
| |
|
| |
 Etwa
zeitgleich mit botanischen Erkundungen von Ascherson
und Schweinfurth begannen autökologische
Studien an Wüstenpflanzen in der Region um
Kairo. Mit den Arbeiten von Georg
Volkens (1887) und Otto
Stocker (1926-28) wurden erstmals ökophysiologische
Messungen unter unterschiedlichen edaphischen
und klimatischen Verhältnissen dieses extremen
Lebensraumes durchgeführt. Diese Studien
wurden später von ägyptischen Wissenschaftlern
wieder aufgegriffen und weitergeführt (z.B.
von Abd
el Rahman, K.H.
Batanouny) Etwa
zeitgleich mit botanischen Erkundungen von Ascherson
und Schweinfurth begannen autökologische
Studien an Wüstenpflanzen in der Region um
Kairo. Mit den Arbeiten von Georg
Volkens (1887) und Otto
Stocker (1926-28) wurden erstmals ökophysiologische
Messungen unter unterschiedlichen edaphischen
und klimatischen Verhältnissen dieses extremen
Lebensraumes durchgeführt. Diese Studien
wurden später von ägyptischen Wissenschaftlern
wieder aufgegriffen und weitergeführt (z.B.
von Abd
el Rahman, K.H.
Batanouny)
 Die
innovative Verwendung von Kraftfahrzeugen ermöglichte
in den 20er und 30er Jahren weite Erkundungsfahrten
durch die Western Desert bis in den Nordsudan
und brachte erste Einsichten in die Landschafts-
und Vegetationsverhältnisse der Ost-Sahara,
die allerdings in botanischer Hinsicht und in
Anbetracht der Grösse des Gebietes eher anekdotisch
blieben. Die
innovative Verwendung von Kraftfahrzeugen ermöglichte
in den 20er und 30er Jahren weite Erkundungsfahrten
durch die Western Desert bis in den Nordsudan
und brachte erste Einsichten in die Landschafts-
und Vegetationsverhältnisse der Ost-Sahara,
die allerdings in botanischer Hinsicht und in
Anbetracht der Grösse des Gebietes eher anekdotisch
blieben.
Mit
der Gründung eines Lehrstuhls für Botanik
an der Cairo University 1925 und der Einrichtung
des Herbariums wurde unter Gunnar und Vivi
Täckholm die floristische Inventarisierung
des Niltals und der umliegenden Wüstengebiete
in Ägypten und seinen Nachbarstaaten fortgeführt
und intensiviert. Die auf diesen Arbeiten fussende
Herausgabe der "Flora
of Egypt", deren erster Teil 1941 veröffentlicht
wurde, ermöglichte dann erst die weitere
vegetationskundliche und ökologische Forschung
in dieser Region.
Auch
Wissenschaftler der TU-Berlin, damals aus dem
Institut für Angewandte Botanik, trugen bereits
in den 50er Jahren mit ihren umfangreichen pflanzenphysiologischen
Untersuchungen wesentlich zum Verständnis
der Überlebensstrategien von Wüstenpflanzen
bei. Zu nennen ist hier vor allem Prof. Ulrich
Berger-Landefeldt, welcher mehrere Beiträge
zur "Ökologie der Pflanzen nordafrikanischer
Salzpfannen" publizierte.
|
| |
|
| |
|
 |
Die
erste Gliederung aus ökologischer Sicht: Habitat-Typen |
| |
|
| |
Die
ökologischen Arbeiten in Ägypten der 50er
und frühen 60er Jahre waren von Mohammed
Kassas und seiner angelsächsisch geprägten
ökosystemaren Sichtweise beeinflusst. Erstmals
wurde versucht, die Teillandschaften der Western
(und Eastern) Desert, soweit bekannt, unter ökologischen
Gesichtspunkten zu charakterisieren und gemeinsame
Habitat-Typen und deren besondere Umweltbedingungen
zu definieren. |
| |
|
| |
|
 |
Vegetationsökologische
Forschung und pflanzensoziologische Erfassung |
| |
|
| |

Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches
69, wesentlich initiiert von dem Geologen
Prof.
E. Klitzsch, mit dem Titel "Geowissenschaftliche
Probleme Arider Gebiete - Geologie, Ressourcen
und Nutzungsmöglichkeiten" (SFB 69
ab 1981 an der  TU-Berlin)
führten die Teilprojekte B6 (Ökologische
Karten der Ostsahara zur Bewertung von Landnutzungen),
B7 (Vergleich von Genese und Dynamik typischer
Ökosysteme der Halbwüste und Vollwüste)
und B8 (Optimierung von Bewässerungsverfahren,
des Wasserverbrauchs landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
und des Düngemitteleinsatzes im Bewässerungs-
und Trockenfeldbau) umfangreiche Untersuchungen
durch.
TU-Berlin)
führten die Teilprojekte B6 (Ökologische
Karten der Ostsahara zur Bewertung von Landnutzungen),
B7 (Vergleich von Genese und Dynamik typischer
Ökosysteme der Halbwüste und Vollwüste)
und B8 (Optimierung von Bewässerungsverfahren,
des Wasserverbrauchs landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
und des Düngemitteleinsatzes im Bewässerungs-
und Trockenfeldbau) umfangreiche Untersuchungen
durch.
 Abb.
D2-10/02
(rechts): Abb.
D2-10/02
(rechts):
Projektgebiet und Forschungsreisen. Ausschnitt
bitte anklicken!
|
| |
|
| |
|
| |
An
den drei Teilprojekten war wesentlich das  Institut
für Ökologie der TU-Berlin beteiligt.
Vegetationsökologische Untersuchungen wurden
unter der Leitung von Prof. Bornkamm durchgeführt.
Die Forschungsreisen reichten von der Mittelmeerküste
N-Ägyptens bis in das Gebiet des nördlichen
Sudan (vgl. Abb. rechts oben!). Für die Expeditionen
stand ein bestens ausgerüsteter Fahrzeugpark
zur Verfügung, der es ermöglichte, auch
abgelegene und schwer zugängliche Bereiche
der "Western Desert" sicher zu erreichen.
Institut
für Ökologie der TU-Berlin beteiligt.
Vegetationsökologische Untersuchungen wurden
unter der Leitung von Prof. Bornkamm durchgeführt.
Die Forschungsreisen reichten von der Mittelmeerküste
N-Ägyptens bis in das Gebiet des nördlichen
Sudan (vgl. Abb. rechts oben!). Für die Expeditionen
stand ein bestens ausgerüsteter Fahrzeugpark
zur Verfügung, der es ermöglichte, auch
abgelegene und schwer zugängliche Bereiche
der "Western Desert" sicher zu erreichen.
|
| |
|
| |
|
| |
 Alle
Forschungsreisen wurden zusammen mit Bodenkundlern
unseres Instituts durchgeführt (Prof. Stahr,
Prof. Renger, Dr. Alaily u.a.). Damit standen
umfangreiche und detaillierte pedologische Informationen
für die Auswertung der vegetationsökologischen
Untersuchungen (Kehl
& Bornkamm, Stahr
et al.) zur Verfügung. Gemeinsam konnten
so für weite Teile der "Western Desert"
ökologische
Karten entwickelt werden. Alle
Forschungsreisen wurden zusammen mit Bodenkundlern
unseres Instituts durchgeführt (Prof. Stahr,
Prof. Renger, Dr. Alaily u.a.). Damit standen
umfangreiche und detaillierte pedologische Informationen
für die Auswertung der vegetationsökologischen
Untersuchungen (Kehl
& Bornkamm, Stahr
et al.) zur Verfügung. Gemeinsam konnten
so für weite Teile der "Western Desert"
ökologische
Karten entwickelt werden.
 Abb.
D2-10/03
(rechts): Abb.
D2-10/03
(rechts):
Unsere
Fahrzeuge im SFB 69 "Geowissenschaftliche
Probleme Arider Gebiete" an der TU-Berlin.
|
| |
|
| |
|
| |
 Traditionell
wurden Vegetationsgliederungen in Ägypten
und Sudan bis in die 70er Jahre hinein nach rangfreien,
sog. "community-types" vorgenommen (Kassas
et al., Ayyad
et al. ). Erst mit dem Beginn der Arbeiten
unter Reinhard Bornkamm und Mitarbeitern seit
1981 wurden systematisch Vegetationsaufnahmen
nach dem Br.-Bl. - System erhoben (vgl.
Karte unten mit den Aufnahmeorten). Traditionell
wurden Vegetationsgliederungen in Ägypten
und Sudan bis in die 70er Jahre hinein nach rangfreien,
sog. "community-types" vorgenommen (Kassas
et al., Ayyad
et al. ). Erst mit dem Beginn der Arbeiten
unter Reinhard Bornkamm und Mitarbeitern seit
1981 wurden systematisch Vegetationsaufnahmen
nach dem Br.-Bl. - System erhoben (vgl.
Karte unten mit den Aufnahmeorten).
 Abb.
D2-10/04 (oben): Abb.
D2-10/04 (oben):
Reinhard Bornkamm am Z1 - noch unentschlossen
.....
|
| |
|
| |
Dabei
kommt Reinhard Bornkamm der Verdienst zu, integrativ
 pflanzengeographische,
landschaftsökologische und pflanzenphysiologische
Methoden und Analysen miteinander verbunden zu
haben, gewöhnlich unter Feldbedingungen,
die von extremer Hitze, Anstrengung und oftmals
grossem Zeitdruck geprägt waren.
pflanzengeographische,
landschaftsökologische und pflanzenphysiologische
Methoden und Analysen miteinander verbunden zu
haben, gewöhnlich unter Feldbedingungen,
die von extremer Hitze, Anstrengung und oftmals
grossem Zeitdruck geprägt waren.
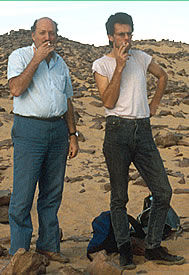 Schon
sehr bald nach Aufnahme der Geländearbeiten
war Reinhard Bornkamm zu der Überzeugung
gelangt, dass selbst die aridesten Teile dieser
Extremwüste nicht gänzlich ohne Leben
sind, sondern als Lebensräume mit - wenn
auch sehr einfachen - Ökosystemstrukturen
angesehen werden können (vgl. Schon
sehr bald nach Aufnahme der Geländearbeiten
war Reinhard Bornkamm zu der Überzeugung
gelangt, dass selbst die aridesten Teile dieser
Extremwüste nicht gänzlich ohne Leben
sind, sondern als Lebensräume mit - wenn
auch sehr einfachen - Ökosystemstrukturen
angesehen werden können (vgl.  Ökologische
Wüstentypen). Ökologische
Wüstentypen).
 Abb.
D2-10/05 (links): Abb.
D2-10/05 (links):
Reinhard Bornkamm mit
Frank Darius bei wohlverdienter Zigaretten-Pause.
 Abb.
D2-10/06 (rechts
unten): Abb.
D2-10/06 (rechts
unten):
Reinhard Bornkamm mit Harald Kehl, nach vielen
Kilometern absolut vegetationsloser Wüste
- endlich eine tote Stipagrostis entdeckt.
 Seine
Veröffentlichungen hierzu (vgl. besonders
autochthone und allochthone Ökosysteme) sowie
die Arbeiten zur ersten pflanzensoziologischen
Gliederung für die Western Desert in
Ägypten, können sicher als Meilensteine
auf dem Gebiet der Wüstenökologie
allgemein und der Vegetationsgliederung speziell
der Ost-Sahara gelten. Zusammen mit dem ökologischen
Kartenwerk, in Zusammenarbeit mit den Kollegen
der Kartografie und geologischen Wissenschaften,
sind diese Arbeiten heute Grundlage jeglicher
vegetationsökologischer Forschung der "Western
Desert" in Ägypten, von der Mittelmeerküste
bis in den Randbereich des Sahel im nördlichen
Sudan. Seine
Veröffentlichungen hierzu (vgl. besonders
autochthone und allochthone Ökosysteme) sowie
die Arbeiten zur ersten pflanzensoziologischen
Gliederung für die Western Desert in
Ägypten, können sicher als Meilensteine
auf dem Gebiet der Wüstenökologie
allgemein und der Vegetationsgliederung speziell
der Ost-Sahara gelten. Zusammen mit dem ökologischen
Kartenwerk, in Zusammenarbeit mit den Kollegen
der Kartografie und geologischen Wissenschaften,
sind diese Arbeiten heute Grundlage jeglicher
vegetationsökologischer Forschung der "Western
Desert" in Ägypten, von der Mittelmeerküste
bis in den Randbereich des Sahel im nördlichen
Sudan.
Von
den Detailuntersuchungen sind besonders
die Arbeiten zwischen
|
| |
 Eine Eine Auflistung
aller gefundenen Pflanzen-Arten (List of all species
determined in the framework of the research project)
- inkl. Angaben zum ChoroType, zur Lebensform, zu
den Fundorten und dem vorliegenden Herbarmaterial,
teilweise auch Fotografien der Arten am Standort
- ) finden Sie hier.
Auflistung
aller gefundenen Pflanzen-Arten (List of all species
determined in the framework of the research project)
- inkl. Angaben zum ChoroType, zur Lebensform, zu
den Fundorten und dem vorliegenden Herbarmaterial,
teilweise auch Fotografien der Arten am Standort
- ) finden Sie hier.
 [1,1MB]
[1,1MB]
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |
Das
Untersuchungsgebiet in Ägypten und NW-Sudan:
|
|
|
| |
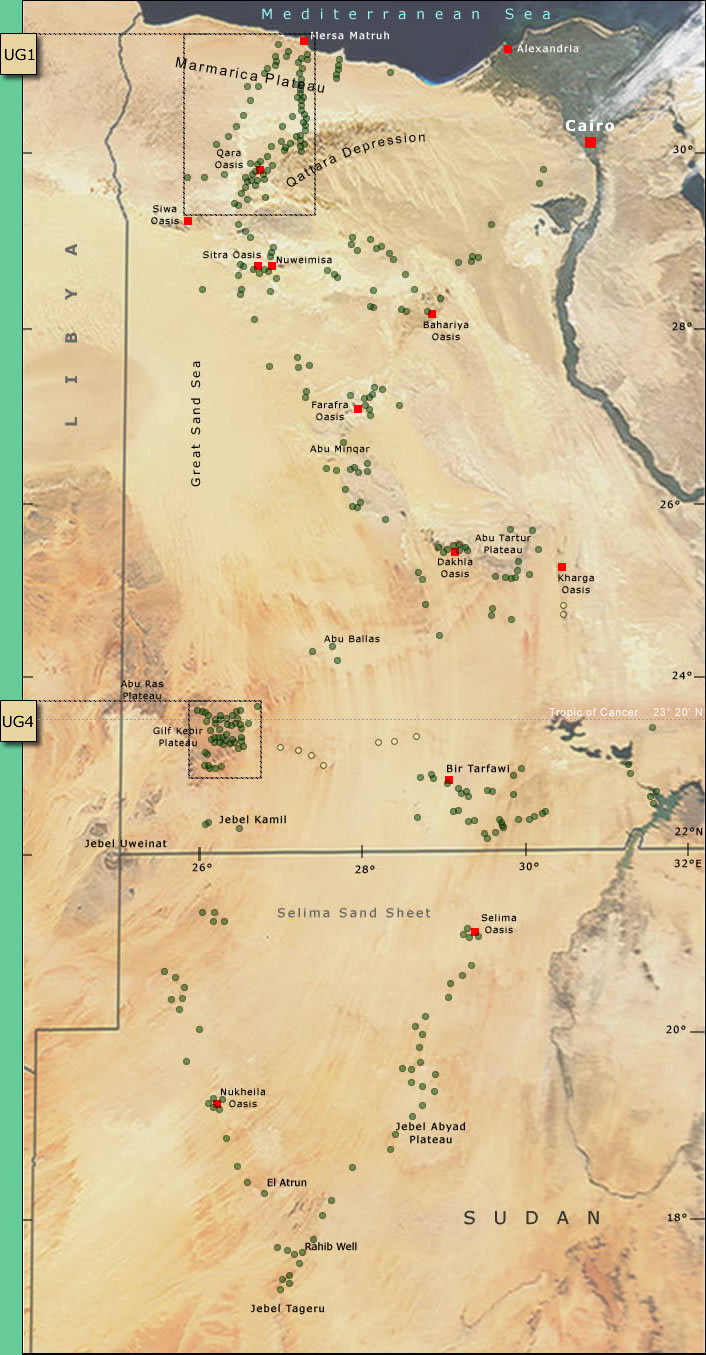
|
| |
|
| |
 Abb.
D2-10/07: Abb.
D2-10/07:
Vegetationskundliche
und ökosystemare Aufnahmeorte von Reinhard
Bornkamm und seinen Mitarbeitern in Ägypten
und im NW-Sudan. Die Eintragungen sind noch nicht
vollständig, werden jedoch kontinuierlich erweitert.
|
| |
|
 |
 |
|
 |
| |
|
 |
Zitierte
und weitere Literatur: |
|
|
| |
 Frühe
Publikationen zur Libyschen Wüste Frühe
Publikationen zur Libyschen Wüste |
| |
|
| |
 Publikationen
von und mit Reinhard Bornkamm Publikationen
von und mit Reinhard Bornkamm |
| |
|
| |
 Publikationen
aus dem Sonderforschungsbereich 69 (SFB
69 - kleine Auswahl ökologischer Publikationen) Publikationen
aus dem Sonderforschungsbereich 69 (SFB
69 - kleine Auswahl ökologischer Publikationen)
|
| |
|
| |
 Weitere
Publikationen aus dem SFB 69 (hauptsächlich
in Berl. Geowiss. Abh., Verlag von Dietrich Reimer,
Berlin) Weitere
Publikationen aus dem SFB 69 (hauptsächlich
in Berl. Geowiss. Abh., Verlag von Dietrich Reimer,
Berlin) |
| |
|
| |
 Publikationen
ägyptischer (u.a.) Wissenschaftler (kleine
Auswahl) Publikationen
ägyptischer (u.a.) Wissenschaftler (kleine
Auswahl) |
| |
|
| |
 Weitere
Publikationen (kleine
Auswahl) Weitere
Publikationen (kleine
Auswahl) |
| |
|
| |
|
 |
Internet Ressourcen
|
| |
|
| |
 Kleine
Auswahl, wird lfd. erweitert Kleine
Auswahl, wird lfd. erweitert |
| |
|
 |
Liste
aller gefundenen Pflanzen
|
| |
|
| |
 Ägypten
und N-Sudan, inkl. tw. Fotos, Fundorte u. Details Ägypten
und N-Sudan, inkl. tw. Fotos, Fundorte u. Details |
| |
|
 |
Landschaften
der Sahara und weitere interessante Informationen
|
| |
|
| |
 Impressionen
aus Ägypten bis N-Sudan Impressionen
aus Ägypten bis N-Sudan |
| |
|
|
|
|
|
|